Mit DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT legt die 1992 in Russland geborene und 2024 vor Verfolgung nach Deutschland geflohene Jegana Dschabbarowa einen Roman vor, der uns immer wieder mit der Wucht eines Schlages trifft, aber in tiefer Hoffnungslosigkeit auch Stärke, Licht und Zuversicht birgt.
„Bemerkenswert genau bewahrt der Körper die Fakten, verzerrt sie nicht, er merkt sich für immer, was mit ihm passiert: Hier und dort lassen sich archivarische Narben, Kratzer, blaue Flecken, Spuren von Verbrennungen entdecken, der Körper verzeiht keine Fehler. Das Einzige, was er mit Leichtigkeit vergisst, ist Schmerz.“
Wo anfangen, über dieses Buch nachzudenken, das in der fließenden Übersetzung von Maria Rajer auf 139 Seiten so viel erzählt – mit einem Inhalt, der kaum schwerer sein könnte, und doch immer wieder einem Ton, der staunen lässt und dafür sorgt, dass wir uns verlieben in diesen Text, in dem es um Lieblosigkeit geht, um Brutalität gegen Frauen und um die Verheerungen einer Krankheit, für die es keine Heilung gibt.
Fangen wir mit ihm an, dem Körper. Die Autorin Jegana Dschabbarowa, als Tochter aserbaidschanischer Eltern in Russland geboren, hat ihren autofiktionalen Roman DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT aus elf Texten komponiert, die allesamt den Eindruck machen, in sich abgeschlossen zu sein, aber im Vielklang die Geschichte einer Frau erzählt, die ihres Körpers – und die der Frauen ihrer Familie. Die Kapitel sind Augenbrauen und Augen gewidmet, Haaren, Mund, Schultern, Händen, Zunge, Rücken, Beinen, Hals und Bauch.
Die Augen von Jegana Dschabbarowa sollen nicht für den freien Blick bestimmt sein, ihr Mund besser nie lernen, frei zu sprechen: In der aserbaidschanischen Kultur gibt nur die Hochzeit der Frau das Recht auf Veränderung – selbst zum Zupfen der Augenbrauen, während die russischen Mädchen, mit denen die Autorin in die Schule geht, dies bedenkenlos tun. Jegana mag ihre Brauen nicht, und ihre Augen, die eine andere Farben haben als die ihrer Freundinnen, erscheinen ihr so hässlich, dass sie bitterlich weinen muss:
„Endlich beruhigte ich mich, [meine Augen] waren also nicht nur braun, sie hatten auch einen Hauch Grün, auch wenn er erst nach vielen Tränen zum Vorschein kam: Meine Augen wurden nur in den Minuten der Verzweiflung heller, als wäre das Leid ein Bleichmittel – der notwendige Preis für das ‚Schöne‘.“
Wenn ein Körper misshandelt wird – und dadurch, im mehrfachen Sinn, der Mensch
Jegana Dschabbarowa wird in eine Familie geboren, in der die Gewalt alltäglich ist – der Großvater schlägt seine Frau voll rasender Eifersucht und stirbt mit dem Blick auf ihr Foto gerichtet, um sie keine Sekunde aus den Augen zu lassen. Auch der Mutter der Erzählerin bleibt nichts anderes übrig, als die Schläge ihres Mannes zu erdulden, und das hat Folgen für ihre Tochter:
„Mit jedem Schlag gegen Mutters rechtlosen Körper prügelte er unsere Freiheit in den Sarg, warf Erde über unsere Hoffnung, stampfte mit seinen großen Füßen unsere kleinen Körper fest in einer Kiste mit der Aufschrift ‚Frau‘. | Für eine Frau gehört es sich nicht zu sprechen, für eine Frau gehört es sich nicht zu widersprechen, eine Frau darf nie vergessen, dass sie Objekt, nicht Subjekt eines Satzes ist, doch das Wichtigste, das uns seine Fäuste lehrten, war zu schweigen, unsere Hoffnungen und Träume für uns zu behalten, unsere schrecklichen Geheimnisse niemals jemandem anzuvertrauen.“
Später im Buch gibt es eine eindringliche Szene, in der Frauen für kurze Augenblicke eingestehen, was ihnen passiert – einmal mehr zeigt sich, dass es Gewalt auch deswegen gibt, weil die Opfer erzogen werden, sie auszuhalten:
„Die Frauen tauschten vorsichtige Blicke und lebten plötzlich auf, eine freudige Anspannung wurde spürbar: Sie freuten sich nicht darüber, dass eine von ihnen verprügelt worden war, sondern darüber, dass sie endlich für einen Augenblick die Maske der Ehrbarkeit ablegen und zugeben konnten, dass die Ehe keine besonders angenehme Sache war. Allerdings endeten diese Bekenntnisse immer gleich, die Älteste bemerkte philosophisch, das sei nun mal der Frauen Los […]. Die anderen verstummten, und fünf Minuten später legten sie wieder ihre Masken der ehrbaren, glücklichen Ehefrauen an.“
Kleine Glücksmomente – und sehr viel, was das Gegenteil bedeutet
Zum Glück, und das sei auch erwähnt, gibt es einen Mann in der Familie von Jegana Dschabbarowa, der anders ist: ihren zweiten Großvater. Den, der nicht nur Schule ging, der lieber mit seinen Schafen redete als mit den Menschen; der, der seiner Frau ein Leben lang nie widersprach und seiner Enkelin das gab, was sie brauchte:
„Er geizte nicht mit Zärtlichkeit, er trug uns auf seinem Rücken über Bergflüsse, auch als wir längst groß geworden waren. Die wichtigsten Lektionen – wie man liebt, sanft und zärtlich ist, das Schöne sieht, Worte sagt – habe ich von ihm gelernt. Wir schauten zusammen auf einem schwarzweißen Bildschirm Horrorfilme – es gab keinen Ton, deswegen mussten wir sie selbst vertonen. Er erzählte gern Geschichten – wir wussten nie, ob sie wahr oder erfunden waren, und als er starb, endete die Welt, die er uns geschenkt hatte, fiel in den Fluss, wie einmal sein geliebtes weißes Taschentuch.“
Wovor der Großvater seine Enkelin nicht bewahren kann: die Fremdenfeindlichkeit der russischen Gesellschaft, die stellvertretend steht für viele andere. In der Schule wird Jegana Dschabbarowa selten mit dem eigenen Namen angesprochen, sondern mit einem Schimpfwort, das die Herkunft ihrer Eltern markiert; sie wird geschlagen, ein Zeigefinger gebrochen, der nie wieder heilt, „als Erinnerung daran, dass fremd zu sein immer bedeutet, Feind zu sein“.
Die Szene, in der das Mädchen in eine Demonstration gerät, bei dem der glatzköpfige Mob „Russland den Russen“ skandiert und keinen Zweifel daran lässt, was er dem Kind antun will, gehört zu den vielen eindringlichen in diesem Buch, von denen man wünscht, sie nicht gelesen zu haben, sie aber auch nicht missen will: „Ich hatte es schon früher bemerkt, aber nie darüber nachgedacht, wie sehr Menschen Gefäße für Jähzorn brauchen.“ Wäre man Unmensch, man würde jenen, die in Deutschland von „Remigration“ faseln, diese Erfahrung am eigenen Leib wünschen.
Jegana Dschabbarowa erzählt in DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT auch von ihrem Kampf gegen die neurologische Krankheit Dystonie
Und dann gibt es da noch die Krankheit, die Jegana Dschabbarowa in grausamer Kontrolle fesselt: Ihre Dystonie ist symbolträchtig, denn was mit Problemen beim Sprechen beginnt, verzerrt schließlich den ganzen Körper, lässt den Menschen – und hier: die Frau – noch schutzloser werden. Die Autorin lässt uns ahnen, wie es sich anfühlt, wenn der Körper in einen „dystonischen Sturm“ gerät, wenn der Verstand erleben muss, wie ihm jede Kontrolle entzogen wird. Eine Operation und das Einsetzen eines Stimulators wird schließlich zur Rettung, ohne aber die Krankheit besiegen zu können:
„Manchmal schalte ich den Stimulator aus, um zu sehen, wie die Dinge in Wirklichkeit stehen: der Neurologe hatte mich gewarnt, der Stimulator sei wie eine Maske, er halte die Krankheit nicht auf – er maskiert sie nur. Ohne ihn kann ich nicht mehr sprechen, ich kann meinen Mund nicht schließen: Mein Mund erstarrt wie eine Totenmaske, geöffnet und immer zum Schreien bereit.“
In diesem Buch liegt alles nah beisammen: Das Schreckliche, das Archaische auch in der modernen Welt, die Grausamkeit einer Krankheit – und dann, fast so, dass man es zu überlesen droht, auch das Helle (oder zumindest: das Hoffnungsvolle), das es selten gibt, dann aber von den Buchseiten leuchtet. Das alles kommt unter anderem in diesem Moment zusammen, in dem Jegana Dschabbarowa vor ihrer OP die Haare geschoren werden:
„Alles: Meine Vergangenheit, die Vergangenheit meiner Familie, die Geschichte eines einzelnen Körpers – das lag nun auf dem kalten Boden des Behandlungsraums. Ich wusste, dass ich nie wieder ein Teil der Vergangenheit sein würde, nie mehr so leben würde wie bisher, mir nie mehr lange Zöpfe flechten würde wie meine Großmütter, mir war ein vollkommen anderes Schicksal zugedacht.“
Dieses andere Schicksal macht Jegana Dschabbarowa zur Dichterin, Essayistin und Wissenschaftlerin – aber auch, und das soll erwähnt werden, obwohl es erst nach der Erstveröffentlichung des Buchs geschah, erneut zum Opfer: Anfang 2024 musste sie nach Todesdrohungen und Schikanen aus ihrer Heimat fliehen. Eine neue findet sie nun hoffentlich in Hamburg, wo sie inzwischen lebt. Dort lernt sie eine weitere Sprache, und deswegen möchte ich diese Gedankensammlung mit einem weiteren Zitat in Richtung Ende führen:
„In der Schule sprachen alle Russisch, aber zu Hause hörte ich Aserbaidschanisch oder Mutters türkische Soaps. Von klein auf war mir klar, dass es, wenn ich mehrere Sprachen spreche, auch mehrere Versionen von mir gibt. […] Es gab besondere Worte, die niemals übersetzt wurden, sie existierten wie Pflanzen oder Blüten: einfach so, diese Worte existierten wie Körperteile, organisch und unerklärlich, wie ein geheimes Wissen, ohne das es unmöglich war, in die Familiengeschichte vorzudringen.“
Ich wünsche der Autorin von Herzen, dass sie sich diese Worte immer bewahren wird, sie aber auch im Deutschen solche findet, die essenziell für sie werden.
DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT ist der Titel von Jegana Dschabbarowas Buch – was für eine Bereicherung und was für ein Glück, dass sie mit dieser Bestimmung brechen konnte.
***
Ich habe dieses Buch nicht gekauft, sondern als Rezensionsexemplar vom Verlag erhalten. Bei meiner Rezension handelt es sich trotzdem nicht um eine beauftragte oder bezahlte Werbung: Sie gibt lediglich meine subjektive und unbeeinflusste Meinung wieder.
Jegana Dschabbarowa: DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT. Aus dem Russischen von Maria Rajer. Zsolnay, 2025.

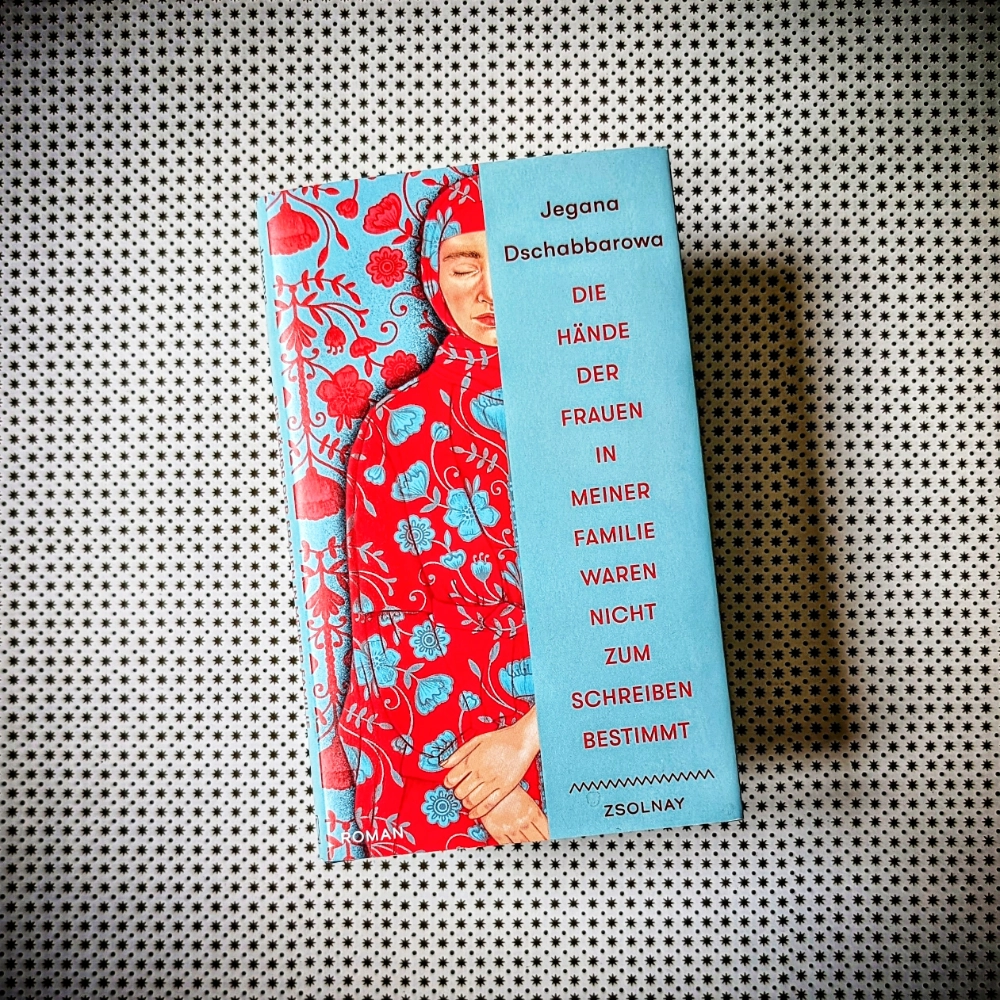
Schreibe einen Kommentar