In ihrem zeitlosen literarischen Debüt ALS DER KAISER EIN GOTT WAR erzählt die Autorin Julie Otsuka von dem, was japanischen Amerikaner*innen im zweiten Weltkrieg angetan wurde – und danach.
„Als die Kinder von der Schule nach Hause kamen, erinnerte sie sie daran, dass sie am nächsten Morgen früh aufbrechen würden. Morgen würden sie verreisen. Und sie könnten bloß mitnehmen, was sie tragen konnten.“
Man kann sich dem Roman ALS DER KAISER EIN GOTT WAR nicht ohne eine kleine Geschichtsstunde nähern: Am 7.12.1941 griffen japanische Streitkräfte die vor Pearl Harbor ankernde US-amerikanische Pazifikflotte an. Die USA erklärten dem Kaiserreich den Krieg und warfen, als das besiegte Japan 1945 die bedingungslose Kapitulation verweigerte, am 6. und 9.08.1945 Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.
Diese Ereignisse sind Teil unseres kollektiven Gedächtnisses – aber was einige von uns vielleicht nicht kennen, ist das Schicksal der Menschen japanischer Abstammung, die damals in den USA lebten: Am 19.02.1942 unterzeichnete Präsident Franklin D. Roosevelt die „Executive Order 9066“, um ca. 120.000 Menschen gegen ihren Willen ins Landesinnere und sogenannte „War Relocation Centers“ umzusiedeln; das 62 Prozent der Betroffenen neben ihren japanischen Wurzeln auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hatten, zählte nicht.
Die Barackensiedlungen lagen fernab von Städten in unwirklichen Gebieten: Das Lager in der Nähe des Ortes Topaz, das im Roman eine Rolle spielt, befand sich beispielsweise in der Sevier-Wüste des Bundesstaates Utah, wo der salzhaltige Boden, die Staubluft und die extremen Temperaturschwankungen ein normales Leben nahezu unmöglich machten.
Genug mit dem Rückblick – jetzt tauchen wir ein in die Geschichte von ALS DER KAISER EIN GOTT WAR
Die Angst der Menschen begann natürlich nicht erst an dem Tag, an dem die Plakate aufgehängt wurden, die sie aufforderten, sich auf den Abtransport vorzubereiten – schon vorher wurden Erinnerungsstücke vernichtet, Traditionen aufgegeben und Versuche unternommen, „ganz normale“ Amerikaner zu werden:
„Am Tag darauf schickte [die Mutter] den Jungen und seine Schwester zum ersten Mal mit Erdnussbutter- und Marmeladenbrot in der Lunchbox zur Schule. ‚Keine Reisbällchen mehr‘, sagte sie. ‚Und wenn jemand fragt, seid ihr Chinesen.‘
Der Junge hatte genickt. ‚Chinesen“, flüsterte er. ‚Ich bin Chinese.‘
‚Und ich‘, sagte das Mädchen, ‚bin die Königin von Spanien.‘
‚In deinen Träumen‘, sagte der Junge.
‚In meinen Träumen bin ich der König‘, sagte das Mädchen.“
Die amerikanische Autorin Julie Otsuka, deren Großmutter, Mutter und Onkel im „Central Utah Relocation Center“ festgehalten wurden, veröffentlichte 2002 ihren von Irma Wehrli fließend ins deutsche übertragenen Roman ALS DER KAISER EIN GOTT WAR, der Parallelen zur Geschichte ihrer Familie hat, aber auf der Grundlage intensiver Recherchen geschrieben wurde; darum tragen die drei Protagonisten – eine Mutter, ihre Tochter und ihr kleiner Sohn – keine Namen, sondern stehen für alle Menschen, die ihr Schicksal hatten.
In klarer, fast nüchterner Sprache erzählt Julie Otsuka von den Vorbereitungen auf die Umsiedlung, von der Zeit im Lager, von der Rückkehr in das, was einmal Normalität war und hoffentlich wieder zu ihr werden soll. Der Roman verdankt seine Eindringlichkeit neben der sanft gezeichneten Brutalität seiner Geschichte der erzählerischen Reduktion. Die Autorin verdichtet das, was der Familie passiert, auf 181 augenfreundlich gesetzte Seiten zu etwas, was man nicht als Minimum missverstehen darf: Sie öffnet uns den Raum für das eigene Nachspüren der Schicksale, lässt uns so unmittelbarer empfinden, in welcher traumatischen Situation ihre Figuren gefangen sind, als wenn sie diese Schicksale auserzählen würde.
Kein Wort zuviel
Julie Otsuka konzentriert sich vor allem auf die Mutter und den Sohn, und dass ich mir gewünscht hätte, mehr über die Tochter zu erfahren, ist kein Mangel des Buchs, sondern eine seiner Stärken.
In ALS DER KAISER EIN GOTT WAR ist kein Platz für Sentimentalität oder durch erzählerische Kniffe gesteigerte Dramatik. Die Personen, denen wir begegnen, fügen sich in ihr Schicksal; wie anders hätten sie damit umgehen können, was doch eigentlich unvorstellbar ist?
„Ihr altes Leben schien [dem Jungen] inzwischen weit weg und entrückt wie ein Traum, an den er sich nur vage erinnern konnte. Das hellgrüne Gras, die Rosen, dass Haus an der breiten Straße unweit des Meeres – das war in einer anderen Zeit gewesen.“
Und doch spürt man sie immer wieder, die Verzweiflung: Die Mutter denkt an den letzten Abend mit ihrem Mann, als er sie bittet, noch einmal aufzustehen, um ihm ein Glas Wasser zu holen, doch sie ist zu müde; als er am nächsten Morgen von Beamten verschleppt wird, bleibt die mit dem irrationalen, umso quälenderen Gedanken zurück, dass er von nun an immer durstig sein wird, wo immer er auch sein mag.
Warum hallt dieser Roman so in uns Lesenden nach?
Was mich fast noch mehr mitgenommen hat als die Schilderungen des Lageralltags ist die Rückkehr ins „normale“ Leben (aber hier komme ich ohne leichte Spoiler nicht mehr aus, ich warne sicherheitshalber vor):
Das Haus ist noch da, aber verwüstet; kaum mehr ist der Familie geblieben als das Silberbesteck, das die Mutter im Garten vergraben hatte. Und wenn sie und ihre Kinder manche ihrer Möbel in den Häusern von Nachbarn zu erkennen meinen? Ist es besser, nicht genau hinzusehen. Der Blick muss nach vorne gerichtet sein, in eine Zukunft, in der man hoffentlich vergessen haben wird, was war, und man sich auch wieder Zeit lassen kann beim Essen, statt alles in sich hineinzuschlingen; im Lager gab es nur für jene einen Nachschlag, die schnell wieder am Tresen standen.
Und irgendwann, auch diese Hoffnung erleben wir mit, wird die Mutter vielleicht wieder im Warenhaus Hüte und Seidenstrümpfe kaufen können, wie sie es früher immer getan hat; jetzt bekommt sie dort aber keine Anstellung, weil ihr Anblick die Kundinnen „vor den Kopf stoßen“ und ihre bloße Anwesenheit „zu Unruhe“ in der Belegschaft führen könnte.
ALS DER KAISER EIN GOTT WAR ist ein Roman, den man aufgrund der Handlungszeit als „historisch“ bezeichnen kann, aber er ist vielleicht aktueller denn je: Julie Otsuka erzählt mit dieser Geschichte leise und kraftvoll gegen das Vergessen an und gegen die Stimmen von „besorgten Bürgern“, wie es sie damals gab und heute immer noch. Zum Ende des Buchs hin begegnen wir auch der Wir-Form, dem erzählenden Chor, der ihre weiteren Romane prägen soll:
In WOVON WIR TRÄUMTEN widmet Julie Otsuka sich der Geschichte japanischer Frauen, die oft unter falschen Voraussetzungen nach Amerika gelockt werden und sich dort ein Leben aufbauen, aus dem sie durch den Irrsinn der Internierung gerissen werden; SOLANGE WIR SCHWIMMEN ist die intensive Auseinandersetzung einer Tochter mit der Demenz ihrer Mutter, in der wir – wenn wir wollen – das Mädchen erkennen können, das in ALS DER KAISER EIN GOTT WAR darauf beharrt, „mehr“ zu sein als nur die Königin von Spanien.
Nicht lange warten – sondern bitte sofort dieses Buch im Handel bestellen!
Ich habe die Romane von Julie Otsuka in der „falschen“ Reihenfolge gelesen, den dritten zuerst, zuletzt den ersten. Und obwohl über zwei Monate zwischen der Lektüre und dem Niederschreiben meiner Gedanken vergangen sind, ist mir die Geschichte noch in vielen Details im Kopf, hallen Entsetzen und Wut in mir nach.
Julie Otsuka als Ausnahmetalent zu preisen liegt nah; gleichzeitig befürchte ich, ihr damit nicht gerecht zu werden. Umso mehr würde mich freuen, wenn ich hiermit nun meinen kleinen Teil dazu beitragen kann, sie in Deutschland bekannter zu machen.
***
Ich habe dieses Buch selbst im niedergelassenen und unabhängigen Buchhandel gekauft. Bei meiner Rezension handelt es sich nicht um eine beauftragte oder bezahlte Werbung: Sie gibt lediglich meine subjektive und unbeeinflusste Meinung wieder.
Julie Otsuka: ALS DER KAISER EIN GOTT WAR. Aus dem Englischen von Irma Wehrli. Lenos Verlag, 2019.

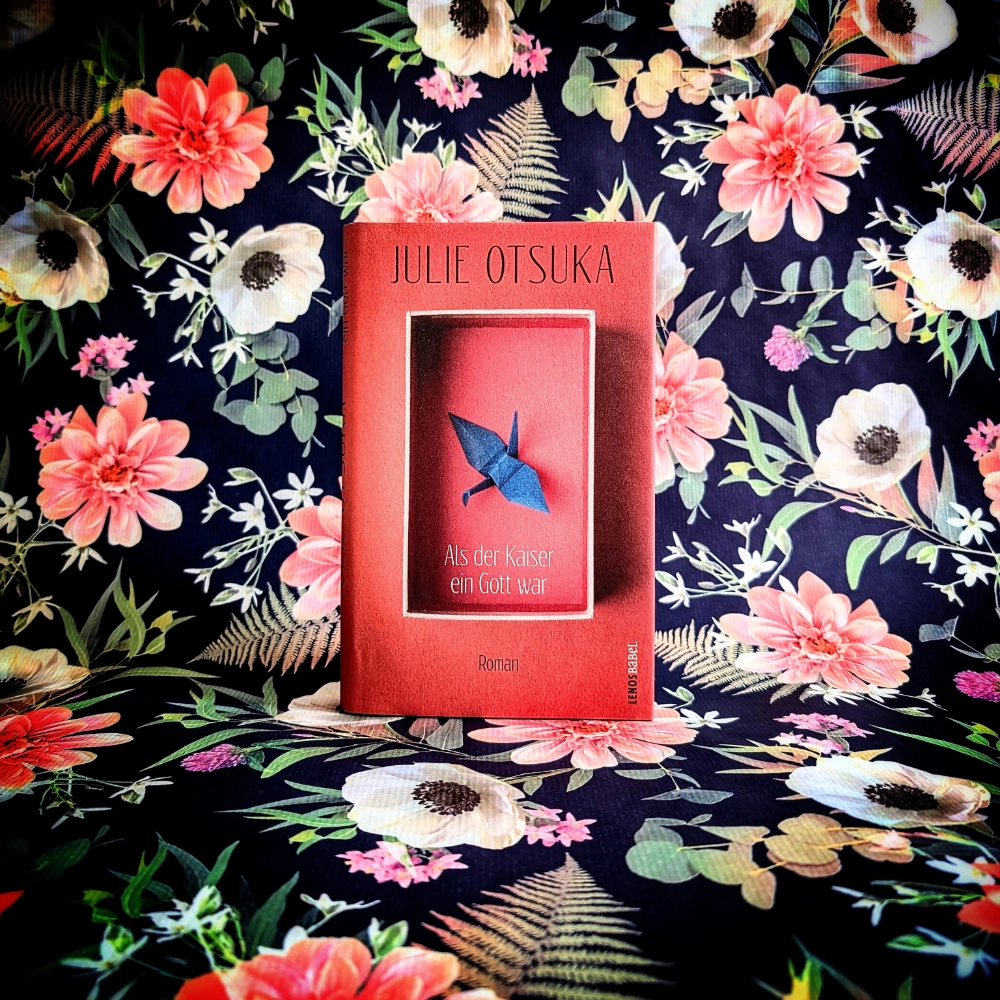
Schreibe einen Kommentar