Der US-amerikanische Autor Ben Shattuck hat mit DIE GESCHICHTE DES KLANGS eine handelsübliche „Der Schwule hat zu weinen im Romane“-Geschichte geschrieben, die der Hanser Verlag als Singleauskopplung herausbringt, um vom potentiellen Erfolg der Verfilmung zu profitieren.
„Als ich den Ton benannte, den meine Mutter jeden Morgen hustete, sagte man mir, ich hätte das absolute Gehör. Wenn am anderen Ende des Feldes ein Hund bellte, konnte ich die Begleitung dazu singen. […] Anfangs dachte ich, jeder könnte Töne sehen. Sie haben Gestalt und Farbe: Ein D ist ein wackliger Kreis, dunkelviolett wie Heidelbeeren. Ich glich meinen Ton mit dem ab, was ich sah, und gab ihm die richtige Stärke. Als ich dreizehn war, bekamen Töne auch einen Geschmack. Wenn mein Vater ein unsauberes H-moll spielte, war mein Mund von einer wachsartigen Bitterkeit erfüllt. Aber ein perfektes C., und ich schmeckte süße Kirschen.“
I bims, 1 Queer-Literatur-Grinch. Zumindest könnte der Verdacht naheliegen, weil ich in kurzer Zeit schon das zweite Buch mit schwuler Handlung ohne wohliges „Hach“ zugeklappt habe, sondern mit einem gereizten „WTF“. Aber der Reihe nach (und mit Spoilern).
Ben Shattuck erzählt in der deutschen (!) Ausgabe von DIE GESCHICHTE DES KLANGS zwei (!) getrennte, aber inhaltlich verbundene Geschichten: In der ersten erleben wir die tragische Liebesgeschichte der beiden Musikstudenten Lionel und David, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch das ländliche Maine ziehen, um Volkslieder auf Wachszylindern aufzunehmen und sie vor dem Vergessen zu bewahren. Für beide ist es die erste (und selbstverständlich tragische!) Liebe, wobei es für Lionel nicht die einzige mit einem Mann bleiben wird. Was auch die Frage klärt, wer die Geschichte überlebt – und wer nicht.
Ben Shattuck erfüllt in DIE GESCHICHTE DES KLANGS den beliebten Literatur-Trope, dass schwule Liebe ein bisschen tragischer sein darf. Und sonst so?
Die Schönheit der Musik und das hoffnungsvolle Sehnen einer Liebe, die in dieser Zeit nicht sein darf: Das füllt 47 augenfreundlich gesetzte Seiten, bei denen der Durchschuss so groß ist, als wolle man hier nicht nur Seiten schinden, sondern auch mit dem Holzhammer klar machen, dass GANZ VIEL zwischen den Zeilen steht. Kann man mögen, klar. Ist eben eine Kurzgeschichte – mit Betonung auf kurz –, die eine 08/15-Handlung (sie lieben sich; sie verlieren sich; das Happy-End ist die Rührung der Lesenden) durch ein bisschen Synästhesie hier und ein bisschen „Ich wollte all die filigranen Ränder der verlorenen Klänge“-Formulierungsverzückung da aufpeppt.
Ich will nicht ungerecht sein: Das hat in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren durchaus Schmelz. Was uns zur zweiten Geschichte führt – und zur Irritation, dass hier im ersten Moment etwas ganz anderes erzählt wird. Denn auf einmal sitzt, Jahrzehnte nach dem not-so-happily-ever-after unserer beiden Goldkehlchen, Annie beim Frühstück und sieht im Fernsehen ein Interview, in dem ein alter Mann sein neues Buch vorstellt: „Wurzeln und Entwicklung der amerikanischen Ballade“ heißt es … und wer sich nun eine Sekunde fragt, wer der Verfasser sein mag, ist vermutlich auch überrascht von dem, was alsbald passiert: Annie findet in dem Haus, in das sie gerade gezogen ist, unter einer Holzdiele verborgen einen Koffer mit Wachszylindern …
Mein erster Gedanke, nachdem ich die gerade mal 104 Seiten gelesen habe: Ja, okay, wäre mehr drin gewesen; schade, dass der Autor nicht die Möglichkeit genutzt hat, die beiden Geschichten miteinander zu verzahnen, ihnen im Wechsel von Gegenwart und Vergangenheit mehr Spannung und Zauber zu geben. Aber wenn der Autor das nicht will: okay.
Warum viel Geld ausgeben, wenn man es doch auch mit weniger Aufwand verdienen kann?
Was ich nun kaufmännisch geschickt, inhaltlich aber fragwürdig finde, ist die Herangehensweise des Hanser-Verlags (und nein, damit meine ich nicht das KI-generierte Umschlagmotiv, das ich, jenseits der Copyright-Problematik, zwar stimmungsvoll gepromptet, aber auch ein bisschen artifiziell zusammenkopiert finde):
Die amerikanische Originalausgabe setzt sich aus 12 (!) Geschichten zusammen, von denen die Hälfte in der Vergangenheit angesiedelt ist und jeweils eine korrespondierende zweite in der Gegenwart. Oder wie der Werbetext es umschreibt: „eine Begleitgeschichte, die eine Offenbarung über die vorherige enthält. Geheimnisse und Morde werden aufgedeckt, die Vergangenheit wird in ein anderes Licht getaucht, Figuren und Familien durch tiefe emotionale Verbindungen verwoben.“ Das klingt super! Und deutlich interessanter, als nun zwei Texte willkürlich aus eben jenem Zusammenhang zu reißen, dem sie im Original vermutlich einen Teil ihrer Wirkung verdanken.
Ui, habe ich jetzt „willkürlich“ geschrieben? Das ist es nicht! Die (auch in der Originalausgabe) titelgebende Geschichte wurde mit Paul Mescal und Josh O’Connor verfilmt. Ein Schelm, wer nach einem enthusiastischen „Coun’t me in whenever O’Connor drops his pants“ noch fragt:
Warum sollte man, wie vor Jahrzehnten bei Annie Proulx, Mühe und Kapital investieren, um ein ganzes Buch übersetzen zu lassen? Aus deren AT CLOSE RANGE/AUS HARTEM LAND hätte es doch auch die Erzählung getan, die als BROKEBACK MOUNTAIN bis heute bekannt ist … Da die heitere Zielgruppe „Gays’n’Girls“ vermutlich die Dreiklang-Alliteration „Geld“ anbietet, ist es wirtschaftlich eine clevere Idee, 17 Prozent des Originalinhalts für 20 Euro in den deutschen Buchmarkt zu bringen, um von der Publicity des Films zu profitieren.
Man verstehe mich nicht falsch: Ich weiß, dass Verlage Wirtschaftsunternehmen sind und in Zeiten von Dark Romance und Drachenreitern jeden literarischen Euro zweimal umdrehen müssen. Um es mit den Worten des Boston Globe auszudrücken: „Ein Glanzstück an Einfallsreichtum.“ Ach, Moment … das bezieht sich vermutlich auf das Gesamtbuch, nicht die Idee der Single-Auskopplung?
Man kann auch aus der ausgelutschtesten Idee etwas machen – wenn man will …
Vermutlich wäre ich versöhnlicher, wenn die beiden in der Herstellung aufgepumpten Kurzgeschichten mit großem Atem erzählt würden oder etwas anderes täten, als altbekannte Versatzstücke zu kombinieren – aber genau das versucht Ben Shattuck meiner Meinung nach nicht. Wir erinnern uns: Schwule Männer haben in Romanen (oder Kurzgeschichtenbänden) schon so ein bisschen die Aufgabe, unglücklich zu sein. Wo kämen wir denn sonst hin? (JA, WO KÄMEN WIR DENN SONST HIN?)
Das Bild, das sich mir beim Lesen dieser 103 Seiten immer wieder aufdrängte (anders als Lionel mit seiner Synästhesie), ist leider das eines Luftballons, den man davonzischen lässt, ohne ihn zuzuknoten. Zum Glück für den Verlag sehen viele Rezensent*innen dies anders und feiern DIE GESCHICHTE DES KLANGS. Nichts für ungut also. Ihr wisst schon:
„ If we shadows have offended | Think but this, and all is mended | That you have but slumbered here | While these visions did appear.“
***
Ich habe dieses Buch nicht gekauft, sondern vom Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Bei meiner Rezension handelt es sich nicht um eine beauftragte oder bezahlte Werbung: Sie gibt lediglich meine subjektive und unbeeinflusste Meinung wieder.
Ben Shattuck: DIE GESCHICHTE DES KLANGS. Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Carl Hanser Verlag, 2025.

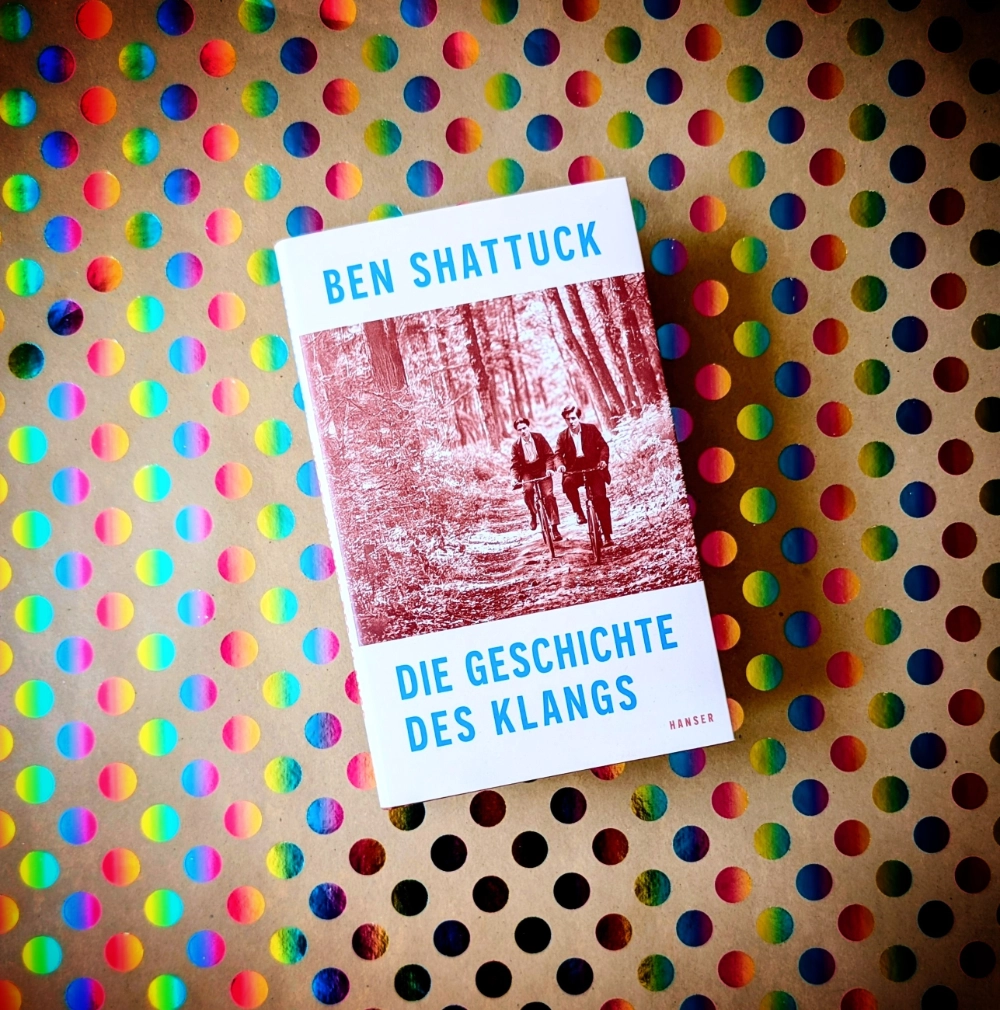
Schreibe einen Kommentar