Inspiriert von der Lebensgeschichte Alice von Battenbergs zeichnet Irene Dische in PRINZESSIN ALICE mit vielschichtigem Humor das Bild einer Frau, die sich dem Göttlichen nahe fühlt – und vielleicht nie versteht, wer und was sie wirklich ist.
„Von jetzt an geht es hier um mich. Alice Mountbatten, die Gott liebte, und auch meine Schwägerin Marie Bonaparte, die Freud liebte. […] Eine dritte Schwägerin spielt noch eine Rolle: die lebenslustige Edwina Mountbatten, die den Sex liebte, in rauen Mengen und mit Männern und Frauen aus jedem Erdteil. Sie war die Erbin eines der größten Vermögens Europas, und es war ich gleichgültig, was andere von ihr dachten. Ihrer Gier nach Genuss war sie um die halbe Welt gefolgt, und nach Paris kam sie just an dem Tag, als Marie ihren Plan in die Tat umsetzen wollte, mich kastrieren zu lassen.“
Victoria Alice Elizabeth Julia Marie Prinzessin von Battenberg (1885–1969), Urenkelin von Queen Victoria und Großmutter des heutigen Königs Charles III., gehört vermutlich zu den schillerndsten Figuren der britischen Monarchie – aber nur wenigen dürfte ihre Geschichte bekannt gewesen sein, bevor die TV-Serie THE CROWN sie in den Mittelpunkt einer Episode stellte: geboren auf Schloss Windsor, gehörlos, aber in der Lage, in diversen Sprachen von den Lippen zu lesen, verheiratet mit einem Spross des griechischen Königshauses (aus dieser Ehe gingen drei Töchter hervor, die deutsche Nazis heirateten – und ihr Sohn Philipp, der als Prinzgemahl von Elisabeth II. bekannt wurde), später mittellos in Paris lebend, bevor sie nach Jahren in verschiedenen Sanatorien ein Nonnenkloster in Griechenland gründete … und schließlich im Buckingham Palace starb.
Fakten und Fiktion
Die amerikanische Schriftstellerin Irene Dische stellt Alice in den Mittelpunkt eines Romans, der keine Biografie sein will, sondern mit den historischen Fakten spielt und so das Leben einer Getriebenen vor uns auffächert, in dem sich vieles vereint: große Tragik, auch bedingt durch eine gefühlskalte Familie, und ein Humor, der mal schwarz ist und mal fein und dabei immer schicksalsergeben. Stets präsent ist Alices Wunsch, anderen zu helfen, von dem nicht zweifelsfrei gesagt werden kann, ob er Herzensangelegenheit war oder nur ein Aspekt ihrer blaublütigen Hybris.
Diese Ambivalenz zeigt sich auch in einem anderen Detail: dem Desinteresse daran, was mit Menschen geschieht, die nicht zu ihrer Familie gehören (Prinzessin Alice scheint, zumindest in der Version, die wir bei Dische kennenlernen, kein größeres Problem damit zu haben, dass der Mann ihrer Lieblingstante für ein grausames Pogrom gegen die Juden von Moskau verantwortlich war) – und der historisch verbürgten Tatsache, dass sie später im Leben eine jüdische Familie vor den Nazis versteckte und bewahrte.
Was uns nun zu der Sache mit Gott führt (und zwischenzeitlich mit Buddha, den wir hier aus Platzgründen unter den Tisch fallen lassen): Alice liebt ihn über alles, sieht ihn aber eher als realen Gesprächspartner, der doch – bitte schön – auf sie zu hören hat. Noch dazu findet sie im Zwiegespräch mit ihm nicht nur größte, sondern auch lautstarke Befriedigung. Aber darf es sein, dass eine Frau vor religiöser Verzückung einen Orgasmus hat? Alices Schwägerin Marie findet – angespornt von Sigmund Freud –: Nein. Und sorgt dafür, dass Alice alles zu verlieren droht …
Von all dem erzählt Irene Dische so rasant, dass es ein Vergnügen ist, und nachdem ich schon auf Seite 1 mehrfach schmunzeln musste („Ohne stolz darauf zu sein, war sie drei Jahrzehnte lang die Schönste in der Familie gewesen, die Trophäe. Sie hatte diese Fackel nicht an eine ihrer Töchter weitergereicht, sondern an ihr Jüngstes, den einzigen Sohn. Das stimmte die Mädchen noch feindseliger.“), bin ich mit großem, wenn auch nicht ungetrübtem Vergnügen durch die 158 Seiten geflogen, die von Tanja Handels fließend ins Deutsche übersetzt wurden.
PRINZESSIN ALICE ist die Geschichte einer Frau, die niemals aufgibt – möglicherweise aber auch mehr Glück im Unglück hat als Verstand …
Die Autorin fängt das Flirren, das vermutlich auch das Wesen der realen Alice ausmachte, hervorragend ein. Was im Roman wahr ist und was verdichtet oder umgedeutet wurde, bleibt offen; ich hätte mir ein Nachwort gewünscht, um zum Beispiel auch die Frage zu beantworten, ob es ihn gegeben hat, den Mann, dem Alice im Sanatorium verfällt, oder ob er, wie vieles andere in diesem Buch, symbolhaften Charakter hat. Für meinen Geschmack, das soll nicht unerwähnt bleiben, war das ein wenig zu viel des Guten; deutlich besser hat mir ein anderes Bild gefallen, ein paar Entenküken, die Alice bekommt, nachdem sie einen ihr lieben (und wertvollen) Schal an eine Marktfrau verschenkt hat.
Das Geflügel wird von Alice und den wenigen Bediensteten ihres Pariser Exils gehegt, aber als Alice ihnen die Freiheit schenkt, holt ihr Bruder sie auf den Boden der Tatsachen zurück:
„Du kannst ja wohl schlecht erwarten, dass irgendwer etwas anderes in ihnen sieht als einen schönen Braten. Und genau das wird jetzt aus ihnen. Aber für dieses Schicksal waren sie auch immer vorgesehen.“
Hier spiegelt sich, was adligen Familien bevorsteht, sobald sie den Schutz verlieren, den Vermögen, Stand und Staatsräson für sie bedeuten – Alice war eng mit der russischen Zarenfamilie verwandt, musste Griechenland zweimal unfreiwillig verlassen und wird ein Leben lang gewusst haben, dass sie und ihre Kinder jederzeit die nächsten Opfer einer Revolution werden könnten. Ohne dies explizit zu schreiben, stellt Irene Dische die Frage, ob man Mitgefühl mit einer Frau haben kann (hier im Sinne von: einer Romanfigur), deren Selbstverständnis sich auch so zeigt:
„Unsere Familie durfte sich nicht mit den vorübergehenden Mächtigen der Erde abgeben, spricht mit ganz normalen Amtspersonen. Präsidenten, Minister und Diktatoren kommen und gehen. Ihre Anliegen sind nicht die unseren. Sie werden nicht von Gott bestellt, sondern von irgendeinem Teil der Bevölkerung.“
Auch das Kruzifix ihrer ermordeten Lieblingstante spielt eine wichtige Rolle im Buch; Irene Dische nutzt es, um die besondere Bedeutung von Gegenständen zu beschreiben, was ihr so eindringlich und zu eigenen Gedanken anregend gelingt wie auch die Darstellung von Alices Schwägerinnen, der grauenhaften Marie (die möglicherweise nicht ganz so ein optisch reizloser Trampel war, wie Alice sie gerne sehen würde) und der von mir im Kontext dieses Romans sehr geliebten Edwina, über die ich bei Gelegenheit mehr herausfinden muss.
Man kann viel rühmen an PRINZESSIN ALICE, allerdings auch beklagen, dass Irene Dische viel zu früh abbricht – ich hätte es spannend gefunden, noch mehr zu erfahren über die Zeit, in der Alice ihr Kloster führte (allerdings, so konnte ich anderswo lesen, trotzdem nicht auf lange Reisen verzichtete), und ihre letzten Jahre im Buckingham Palace. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau: Der Roman steckt voller großartiger Szene (weswegen mein Exemplar durch die vielen Eselsohren deutlich dicker wurde), und wenn Alice zwischenzeitlich in einem verlassenen Palast einen Hofstaat beschwört, der diesen schon lange nicht mehr bewohnt, hat das wie vieles andere in diesem Buch eine eigene und besondere Schönheit, die mich mitgerissen und begeistert hat.
***
Ich habe dieses Buch selbst im niedergelassenen und unabhängigen Buchhandel gekauft. Bei meiner Rezension handelt es sich nicht um eine beauftragte oder bezahlte Werbung: Sie gibt lediglich meine subjektive und unbeeinflusste Meinung wieder.
Irene Dische: PRINZESSIN ALICE. Aus dem Englischen von Tanja Handels. Claassen, 2025.

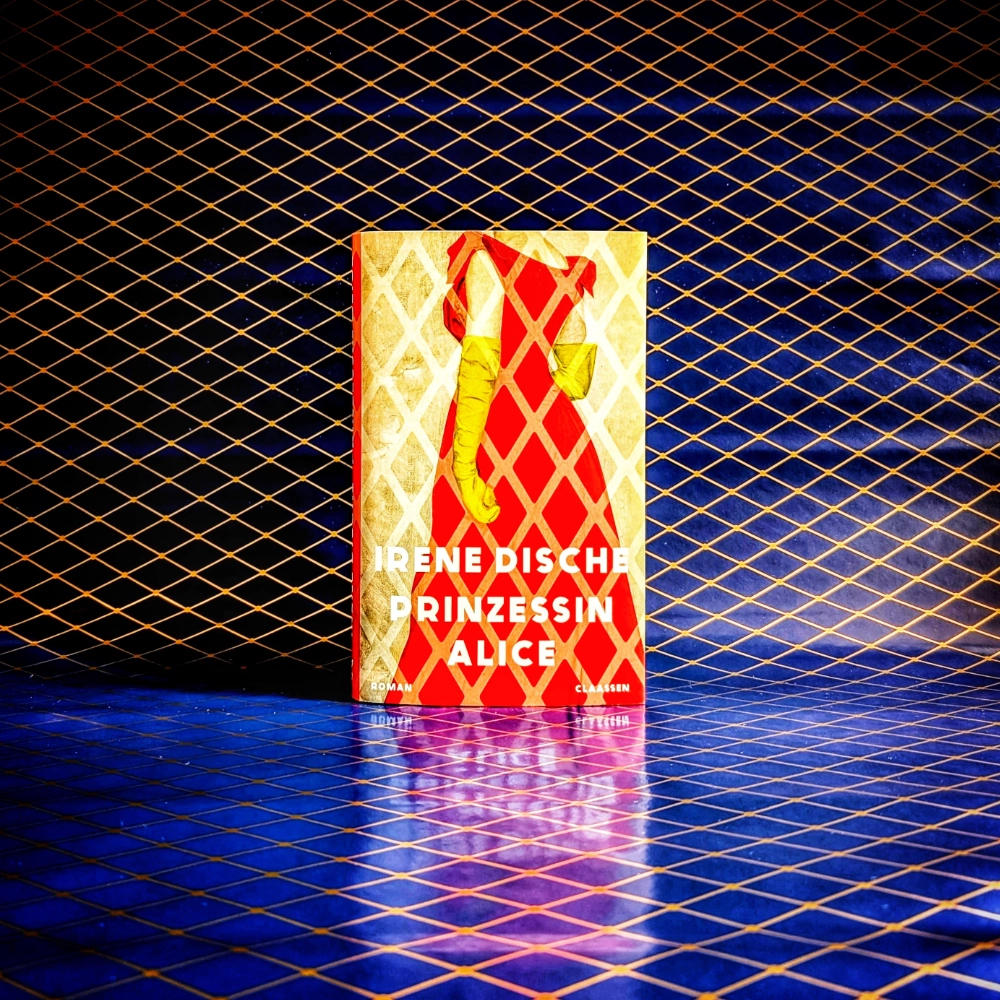
Schreibe einen Kommentar